Die Festung Königstein ist eine der größten Bergfestungen in Europa und liegt mitten im Elbsandsteingebirge auf einem Tafelberg oberhalb des Ortes Königstein am linken Ufer der Elbe. Über 800 Jahre Geschichte haben diese Wehranlage zu einem eindrucksvollen Ensemble von Bauwerken der Spätgotik, der Renaissance, des Barock und des 19. Jahrhunderts werden lassen.
Infos über die Festung und was es auf der Festung zu entdecken gibt will ich in diesem Beitrag zeigen.
Fakten zur Festung Königstein
Die Festung selbst befindet sich auf einem 9,5 Hektar großem Felsplateau direkt neben dem Ort Königstein am Flussufer der Elbe. Scherbenfunde belegen, das schon in der Bronzezeit, also etwa im Jahr 1.100 v. Chr., Siedler auf dem Plateau lebten.
Der Berg thront 240 Meter über der Elbe und zeugt mit 50 Bauwerken, die teilweise über 400 Jahre alt sind, vom militärischen und zivilen Leben auf der Festung.
Der Rundgang der Festung ist 1.800 Meter lang und hat bis zu 42 Meter hohe Mauern und Sandstein-Steilwände. Im Zentrum der Anlage befindet sich der mit 152,5 Metern zweittiefste Burgbrunnen Europas.
Baugeschichte der Festung
I. Die mittelalterliche Burg
Im Jahr 1233 wird in einer Urkunde König Wenzels I. von Böhmen wird ein „Burggraf Gebhard vom Stein“ genannt, damit ist vermutlich der Königstein gemeint. Das Gebiet gehörte damals zum böhmischen Königreich.
1241 folgt dann die erste vollständige Bezeichnung „Königstein“ in der Oberlausitzer Grenzurkunde, die Wenzel I. „in lapide regis“ (lat.: auf dem Stein des Königs) siegelt.
In den Jahren 1406 bis 1409 gelangt die Anlage während der Dohnaischen Fehde in den Besitz der Wettiner (sächsisches Herrschergeschlecht). 1459 wird dann dieser Zustand mit dem Vertrag zu Eger rechtlich fixiert.
II. Das Kloster
Zwölf Cölestinermönche und ein Prior beziehen im Jahr 1516 das von Herzog Georg dem Bärtigen gegründete „Kloster des Lobes der Wunder Mariae“ auf dem Königstein, das bis 1524 besteht.
Auf Befehl des Kurfürsten August wird unter Leitung des Freiberger Bergmeisters Martin Planer der mit 152,5 Metern tiefste Brunnen in Sachsen abgeteuft. Die gesicherte Wasserversorgung ist eine wichtige Voraussetzung für den Festungsbau. Das geschah im Jahr 1563.
III. Der Ausbau zur Festung
Der Startschuss für den Ausbau der Festung wird auf das Jahr 1589 datiert. Kurfürst Christian I. befiehlt den Ausbau der Burg zur Landesfestung. Bis zum Jahr 1594 entstehen z.B. das Torhaus, die Streichwehr, die Alte Kaserne, die Christiansburg (Friedrichsburg) und das Alte Zeughaus. In den folgenden Jahrhunderten werden die Verteidigungsanlagen immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, sodass es kein Feind wagt, die Festung anzugreifen. Auf Grund der militärischen Uneinnehmbarkeit des Königsteins suchen die sächsischen Landesherren in unruhigen Zeiten hinter den dicken Mauern Zuflucht und bewahren hier Kunstschätze und den Staatsschatz auf. Wegen seiner landschaftlich reizvollen Lage ist der Königstein auch beliebtes Ausflugsziel des Hofes und Veranstaltungsort für zahlreiche Feste.
IV. Das Staatsgefängnis
Der erste Staatsgefangene, Dr. Martin Mirus, wird im Jahr 1588 auf den Königstein gebracht.
Bis zum Jahr 1922 gibt es mehr als tausend Gefangene auf dem Königstein. Unter ihnen befanden sich u. a.:
Johann Friedrich Böttger, Miterfinder des europäischen Porzellans (1706/07), der
russische Revolutionär Michail Bakunin (1849) und der Sozialdemokrat August Bebel (1874).
Bis zum Schluss gilt der Königstein als das gefürchtetste Staatsgefängnis Sachsens.
V. Das 19. und 20. Jahrhundert
Das vermutet man kaum, aber Napoleon inspizierte am 20. Juni 1813 die Festung Königstein
Während des Maiaufstandes in Dresden im Jahr 1849 dient der Königstein erneut als Zufluchtsort für die sächsische Königsfamilie. Nach der Niederschlagung des Aufstandes nimmt er die verhafteten Revolutionäre als Gefangene auf.
Zuvor geschah dies schon einmal, nämlich zu Beginn des Siebenjährigen Krieges (1756-63), als die sächsische Armee auf der Ebenheit am Lilienstein gefangen genommen wurde. Der Kurfürst und sein Hofstaat haben sich auf dem Königstein in Sicherheit gebracht. Die Festung wird für neutral erklärt.
Nach dem für Sachsen verlorenen Preußisch-Österreichischen Krieg muss der Königstein im Jahr 1866 an einen preußischen Kommandanten übergeben werden und erhält eine preußische Besatzung.
Vier Jahre später, während des Deutsch-Französischen Krieges wird die Festung erstmals als Kriegsgefangenenlager genutzt.
Nach der Reichsgründung 1871 wird der Königstein als einzige sächsische Anlage in das gesamtdeutsche Festungssystem eingegliedert und erhält wieder eine sächsische Garnison.
Die Festung wird 1914 zum Kriegsgefangenenlager für russische und französische Offiziere und Soldaten.
Später, im Jahr 1939, wird die Festung zum Kriegsgefangenenlager. Zunächst für polnische Gefangene, später für französische Generale und Offiziere.
Dem französischen General Henri Giraud gelingt 1942 die Flucht aus dem Offiziersgefangenenlager.
Die Besatzung übergibt 1945 das Kommando den französischen Kriegsgefangenen. Später wird das Gefangenenlager von einer amerikanischen Sondereinheit evakuiert und die Festung von der Roten Armee besetzt, die auf dem Königstein ein Lazarett einrichtet.
Ab 1949 dient der Königstein als Jugendwerkhof, in dem politisch unbequeme Jugendliche und solche, die infolge der Kriegswirren straffällig geworden sind, erzogen und ausgebildet werden.
VI. Das Museum
1955 wird die Festungsanlage der Öffentlichkeit als militärhistorisches Freilichtmuseum zugänglich gemacht.
Im Jahr 1991 geht die Festung Königstein in das Eigentum des Freistaates Sachsen über (Staatlicher Schlossbetrieb). Im Jahr 2000 wird die Festung Betriebsgesellschaft mbH wird gegründet und ist seit dem Jahr 2003 gemeinnützige GmbH.
Ausstellungen der Festung Königstein
Bei einem Besuch der Festung kannst Du nicht nur die Landschaft und die Bauten auf dem Tafelberg bestaunen. Immer wieder gibt es Ausstellungen die manchmal von langer Dauer, ein andern mal etwas kürzer aber auf jeden Fall immer interessant und nie langweilig sind.
Das Alte Zeughaus und die Artillerie der Festung Königstein
Hier werden Verteidigungswaffen der Festung ausgestellt. Darunter eindrucksvolle historische Kanonen und Mörser, welche einst tatsächlich Teil der Bewaffnung des Königsteins waren.
Ausstellung im Brunnenhaus
Mit über 152 Metern Tiefe ist der Brunnen auf der Festung Königstein der zweittiefste seiner Art in Deutschland. Zwischen 1566 und 1569 ließ Kurfürst August den Brunnen von Bergleuten aus dem Erzgebirge bauen. Noch heute sind Spuren ihrer Meißel im Brunnenschacht zu sehen. Der Blick in den tiefen Schacht ist in jedem Falle etwas ganz Besonderes und daher kann ich jedem Besucher den Gang in das Brunnenhaus empfehlen.
Garnisonskirche
Ursprünglich war sie eine romanische Burgkapelle. Sie ist die erste Garnisonskirche Sachsens und wurde nach einer umfangreichen Sanierung im Jahr 2000 wieder eingeweiht. Die recht kleine Kirche hat kein besonders großes Fassungsvermögen, ist aber dafür ein recht ruhiger Ort und lädt zum Verweilen ein.
Georgenburg
Eine neue Ausstellung zur Renaissancezeit zeigt eine prachtvolle Nachbildung eines Kurfürstenpaares: Johann Georg I. von Sachsen und Magdalena Sibylla. Festliche Verzierungen und Schmuckstücke säumen die nachgestalteten Kleider. Die Ausstellung befasst sich mit dem Leben des Kurfürsten und seiner Gemahlin, dem Baugeschehen aus dieser Epoche und dem dreißigjährigen Krieg.
Es ist auch eine Ausstellung zum Gefangenendasein auf dem Königstein in der Georgenburg zu sehen. Königstein diente als Staatsgefängnis. Es gab aber auch weitere Haftanstalten, für Bau-, Militär- und Kriegsgefangene. Hier wird über Schicksale der Inhaftieren, zu denen unter Anderem auch August Bebel gehörte, informiert.
Magdalenenburg
Einst wurde sie als Renaissanceschlösschen errichtet, diente der Unterbringung des Hofes und als Provianthaus. Im Riesenweinfass-Keller stand von 1725 bis 1819 ein 238.600 Liter fassendes Riesenfass. Eine moderne Installation aus Glas, Stahl, Licht und Musik macht die Geschichte des ehemals größten Weinfasses der Welt erlebbar. Mit einer gesonderten Führung ist diese zugänglich.
Einige weitere, teils wechselnde Ausstellungen, gibt es noch auf der Festung. Nähere Informationen findest Du hier:
Heiraten auf dem Königstein – Im Festsaal der Friedrichsburg
Der Barocke Glanz an der Festungsmauer ist unübersehbar, wenn man an der Friedrichsburg vorbei kommt. 1589 wurde die Friedrichsburg als Beobachtungsturm erbaut und im heutigen Festsaal standen ursprünglich Geschütze. 1731 erfolgte dann der Umbau und um die 2000er Jahre dann die Restaurierung und Rekonstruktion.
Heute kann der Festsaal zum besonderen Anlass gemietet werden. Alle Infos rund um dieses Thema findest Du hier:
Öffnungszeiten und Eintrittsgelder
Die Festung kann nur mit gültigem Ticket und gegen ein Eintrittsgeld besucht werden. Sie bietet sowohl auf dem Festungsgelände als auch von der Ferne Teile der beliebtesten Fotomotive der Sächsischen Schweiz. Daher ist sie ein beliebtes Ziel vieler Fotografen und Touristen.
Die genauen Infos zu Öffnungszeiten, Regelungen und Eintritt sind auf der Homepage zu finden.
Öffnungszeiten und Eintritt – Festung Königstein
Diese Kameraausrüstung empfehle ich für die Eroberung der Festung:
Sony α6000 E-Mount-Kamera mit APS-C-Sensor
SONY SEL18200LE 18 mm – 200 mm Objektiv
Fotostativ Rollei Allrounder Carbon Black
Weitere Informationen zur berühmten Festung gibt es auf der Homepage
Dir gefällt ein Bild und Du willst es haben? Kein Problem.

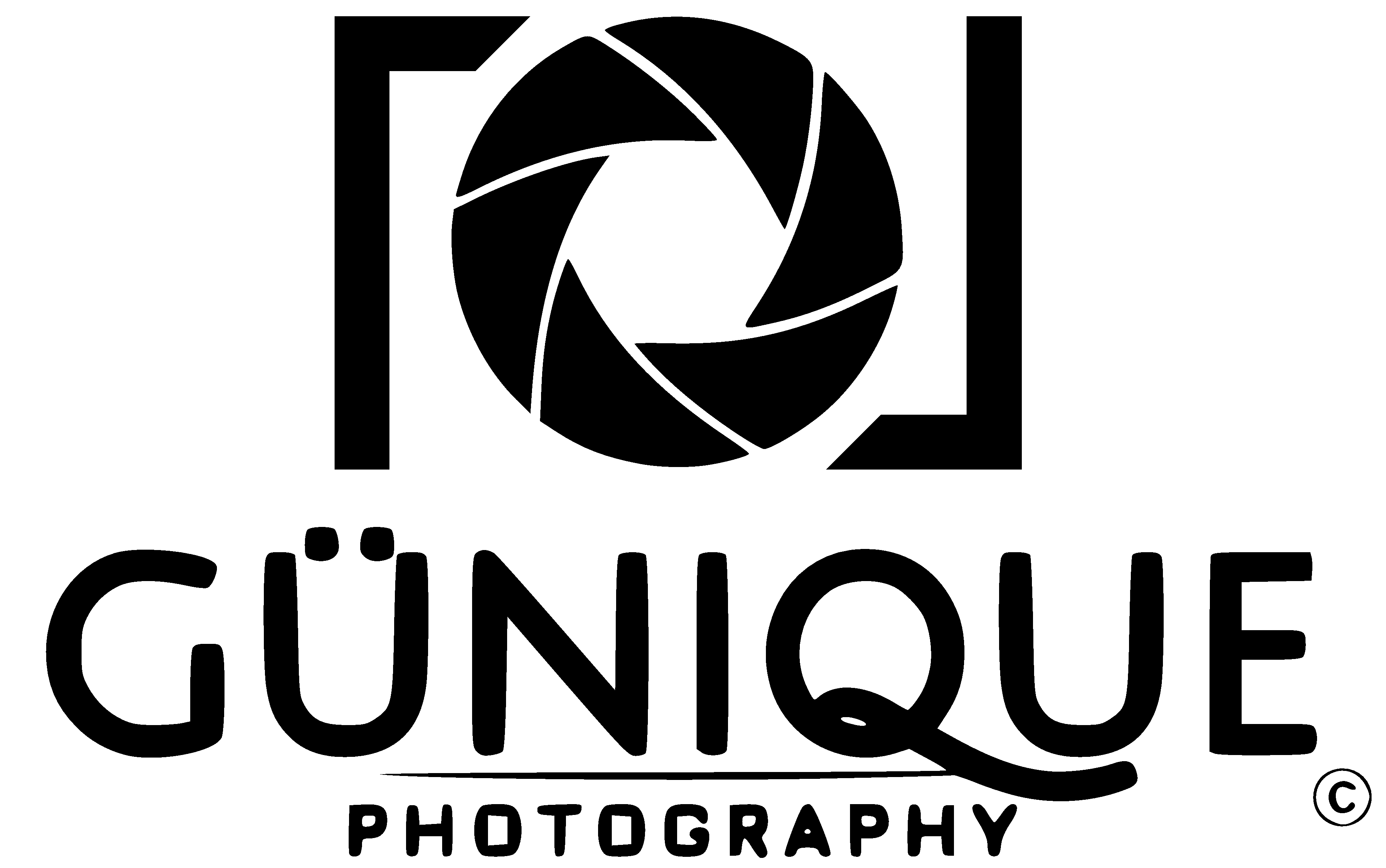










No responses yet